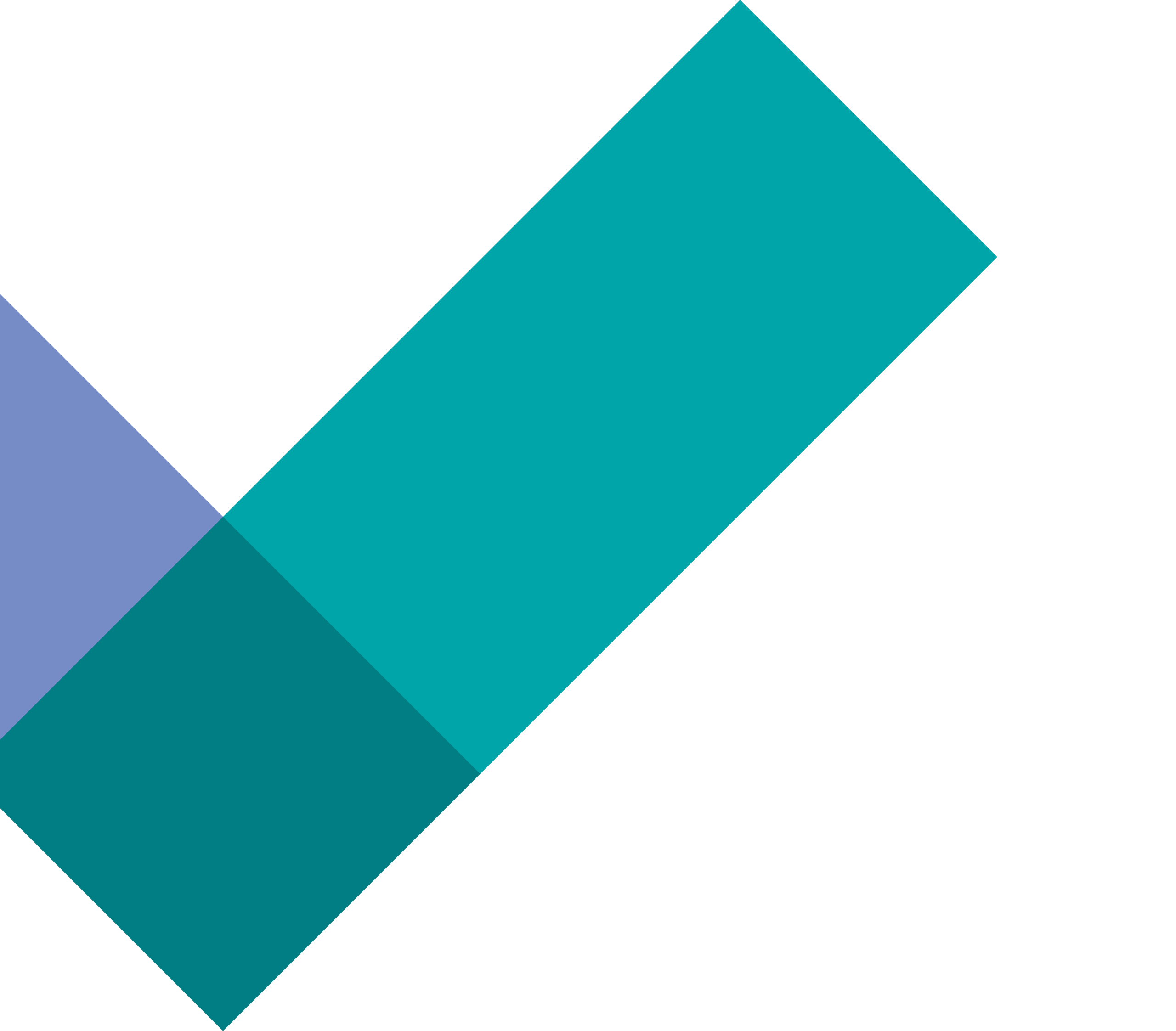Zur Darlegung der Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners – rechtzeitige und aussichtsreiche Sanierungsbemühungen schützen zugleich Schuldner und Gläubiger
BGH, Urt. v. 6.5.2021 – IX ZR 72/20
Wann dürfen Zahlungen entgegengenommen werden mit der Aussicht, diese auch in einer späteren Insolvenz des Schuldners behalten zu dürfen? Für den insolvenzrechtlich nicht geschulten Juristen und erst recht für die betroffenen Kaufleute ist das Insolvenzanfechtungsrecht kaum zu durchdringen. Es erfordert Kenntnisse der feinen rechtlichen Verästelungen und intensive Arbeit am Sachverhalt.
Insolvenzverwalter werden sich in Zukunft schwerer tun, länger zurückliegende Zahlungen anzufechten. Dafür sorgt ein jüngeres Urteil des BGH, mit dem der für das Insolvenzrecht zuständige IX. Senat seine Rechtsprechung ändert. Die bislang sehr weitreichende Rechtsprechung des BGH zur Vorsatzanfechtung wird zurückgenommen. Geschützt werden Gläubiger, die nicht erkennen konnten, dass sich der Schuldner in einer fortdauernden Krise befand. Zugleich setzt der BGH Anreize für eine rechtzeitige Sanierungsplanung.
Grundsätzlich muss der Insolvenzverwalter, der Zahlungen zur Masse zurückfordern will, die „Kenntnis“ des Anfechtungsgegners von einer Gläubigerbenachteiligung nachweisen. Für die Vorsatzanfechtung, die bis zu 10 Jahre zurückreichen kann, muss der Insolvenzverwalter auch den Gläubigerbenachteiligungs-„Vorsatz“ des Schuldners nachweisen. „Kenntnis“ und „Vorsatz“ sind subjektive Tatbestandsvoraussetzungen, also Umstände, die sich ausschließlich in den Köpfen der Gläubiger bzw. der Schuldner abspielen. Da niemand in den Kopf eines anderen hineinsehen kann, muss der Insolvenzverwalter im konkreten Fall die Kenntnis des Anfechtungsgegners von objektiven Umständen darlegen und beweisen, die typischerweise auf eine Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligung und vom diesbezüglichen Vorsatz des Schuldners hindeuten (sog. „Hilfstatsachen“).
Die Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit, die grundsätzlich einen Einblick in die Liquiditätsbilanz erfordert und die darum fast nie nachgewiesen werden kann, ist bei Kenntnis von einer Zahlungseinstellung regelmäßig anzunehmen, § 17 Abs. 2 InsO. Die Kenntnis der Zahlungseinstellung ist leichter nachzuweisen als die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit. Denn Zahlungen sind nach der Rechtsprechung des BGH nicht erst dann eingestellt, wenn gar keine Zahlungen mehr geleistet werden, sondern bereits dann, wenn der Schuldner wesentliche Verbindlichkeiten nicht mehr fristgerecht zahlt. Es kommt auf den „nach außen hervortretenden, objektiven Eindruck“ an. Auch die Erklärung eines Schuldners, nicht mehr zahlen zu können, etwa im Zusammenhang mit einer Stundungsbitte, kann auf eine Zahlungseinstellung hindeuten. Das alles ist bekannt.
Neu ist, dass der Insolvenzverwalter für den Vollbeweis der Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners nicht mehr allein mit dem Vortrag durchdringt, der Anfechtungsgegner habe die Zahlungseinstellung und damit auch die Zahlungsunfähigkeit gekannt und schon deswegen habe er auch Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungs-vorsatz des Schuldners gehabt. Es könne Fälle geben, so der BGH, in denen der Schuldner „aus der maßgeblichen Sicht ex ante trotz eingetretener Zahlungsunfähigkeit berechtigterweise davon ausgehen durfte, noch alle seine Gläubiger befriedigen zu können“. Es reicht nicht aus, so der BGH weiter, „dass der Schuldner weiß, dass er im Zeitpunkt der Vornahme der später angefochtenen Rechtshandlung nicht alle seine Gläubiger befriedigen kann. Entscheidend ist, dass er weiß oder jedenfalls billigend in Kauf nimmt, dass er auch künftig nicht dazu in der Lage sein wird.“
Der BGH begründet diese „neue Ausrichtung“ seiner Rechtsprechung mit systematischen Brüchen der bisherigen Rechtsprechung, die der Gesetzgeber nicht gewollt habe. Die weitergehende Rechtsprechung sei darum zurückzunehmen. Sie habe dazu geführt, dass die auf 3 Monate vor Insolvenz beschränkte Anfechtung auch für kongruente Deckungsgeschäfte, § 130 InsO, untunlich auf bis zu 4 Jahre ausgedehnt werde. Die längere Anfechtungsfrist von 4 Jahren müsse weitere Voraussetzungen haben als die Anfechtung kongruenter Rechtshandlungen im 3‑Monatszeitraum. Im Rahmen der Vorsatzanfechtung spreche darum „die gegenwärtige Zahlungsunfähigkeit allein <…> für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz im hier verwendeten Sinne, wenn sie ein Ausmaß angenommen hat, das eine vollständige Befriedigung der übrigen Gläubiger auch in Zukunft nicht erwarten lässt, etwa deshalb, weil ein Insolvenzverfahren unausweichlich erscheint.“ Ob und unter welchen Voraussetzungen das der Fall sei, habe der Tatrichter zu würdigen.
Aber auch die bisherige Anwendung des Vorsatzanfechtungsrechts auf Fälle nur drohender Zahlungsunfähigkeit gehe zu weit: „Müssen Gläubiger des nur drohend zahlungsunfähigen Schuldners die Vorsatzanfechtung fürchten, können sie geneigt sein, von Geschäftsbeziehungen mit ihm abzusehen oder bestehende Beziehungen zu beenden. Auch dies kann die ansonsten vermeidbare Zahlungsunfähigkeit überhaupt erst herbeiführen und auf diesem Wege letztlich in der Insolvenz münden.“ Maßgeblich sei darum in Zukunft, „ob der Schuldner wusste oder jedenfalls billigend in Kauf nahm, seine übrigen Gläubiger auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht vollständig befriedigen zu können. Entsprechendes gilt für die Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners.“ Auch insofern habe der Tatrichter den Sachverhalt zu untersuchen. Besonders aussagekräftig seien Erklärungen des Schuldners, er könne nicht zahlen. Andererseits sollen „Zahlungsverzögerungen allein, auch wenn sie wiederholt auftreten, nicht schon stets ausreichen“. Es müssen dann „Umstände hinzutreten, die mit hinreichender Gewissheit dafürsprechen, dass die Zahlungsverzögerung auf der fehlenden Liquidität des Schuldners beruht.“ Anzeichen seien die Nicht-Zahlung betriebsnotwendiger Verbindlichkeiten oder die Nicht-Zahlung trotz eines gesteigerten Vollstreckungsdrucks der Gläubiger.
Schließlich weicht der BGH seine bisherige Rechtsprechung auf, dass die Fortdauer der einmal eingetretenen Zahlungsfähigkeit vermutet werde. Das sei nicht stets der Fall. Es komme darauf an, ob eine Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens noch aussichtsreich sei. Der Zeitraum für aussichtsreiche Sanierungen sei allerdings verkürzt, wenn der Vollstreckungsdruck der Gläubiger bereits zugenommen habe.
Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Umstände, die über die erkannte Zahlungsunfähigkeit hinaus für den Gläubigerbenachteiligungs-vorsatz und die Kenntnis von diesem erforderlich sind, trägt der Insolvenzverwalter. Das gelte auch, so der BGH, „soweit es sich – wie bei dem Umstand, dass keine begründete Aussicht auf Beseitigung der Illiquidität bestand – um negative Tatsachen handelt. Dass keine begründete Aussicht auf Beseitigung der Deckungslücke bestand, ist allerdings regelmäßig anzunehmen, wenn die Ursache für die Entstehung der Zahlungsunfähigkeit nicht beseitigt war oder absehbar beseitigt werden würde.“
Der BGH setzt damit zugleich einen Anreiz für rechtzeitige Sanierungsbemühungen. Sind diese unter plausiblen Annahmen aussichtsreich, dürfte es kaum möglich sein, dass ein Insolvenzverwalter den Vollbeweis einer Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Gläubigerbenachteiligungsabsicht des Schuldners darlegen und beweisen kann. Rechtzeitige und aussichtsreiche Sanierungsbemühungen dürften auch ausreichen, um die gesetzliche Vermutung der Gläubigerbenachteiligungsabsicht bei nur drohender Zahlungsunfähigkeit, § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO, zu erschüttern.
Das Urteil des BGH wird zu vielen Kommentaren führen. Missverständnisse sind vorprogrammiert. Der BGH führt zur Zahlungsunfähigkeit nicht das “Prinzip Hoffnung” ein. Die Entscheidung ist auf die Insolvenzanfechtung und damit auf die Sicht der Gläubiger beschränkt. Die Arbeit am Sachverhalt wird noch wichtiger. Das gilt nicht nur für den späteren Anfechtungsprozess. Entscheidend ist, rechtzeitig in der Krise durch fachmännisch begleitete Sanierungsplanungen die Weichen dafür zu stellen, dass jedenfalls in Zukunft (wieder) alle Zahlungen beglichen werden können. Das schützt den Schuldner und seine Gläubiger gleichermaßen.